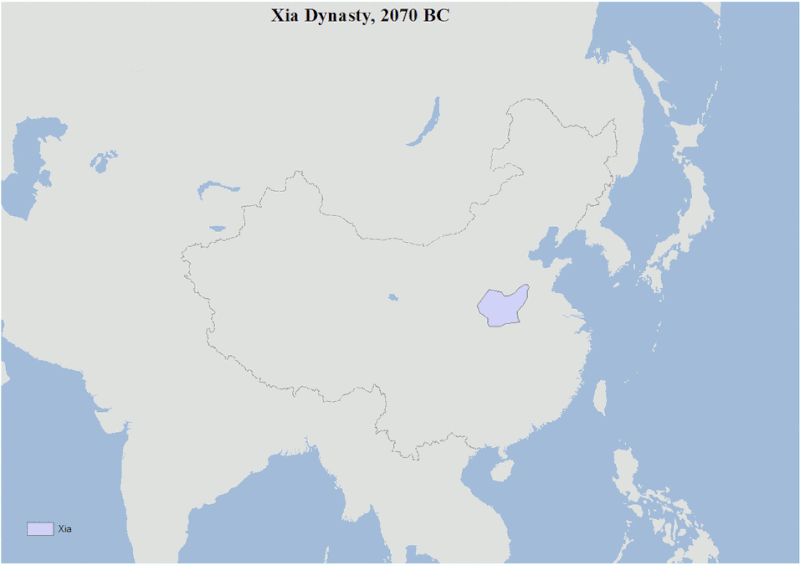Am 21. Oktober findet der Commonwealth-Gipfel in Samoa statt, einem unabhängigen Inselstaat im südwestlichen Pazifik nordöstlich von Fidschi. Hatten diese Treffen bisher vor allem protokollarischen Charakter, droht König Charles III. und Premierminister Sir Keir Starmer dieses Mal Ungemach: Eine Gruppe von 15 karibischen Regierungen hat beschlossen, das Thema Entschädigungen für Sklaverei auf die Tagesordnung des Treffens zu setzen, berichtet die britische Tageszeitung The Mail on Sunday.
Damit ist der Weg für massive Forderungen nach Reparationszahlungen für die Rolle Großbritanniens im Sklavenhandel frei. Entschädigungssummen in Höhe von 200 Milliarden Pfund (derzeit etwa 240 Milliarden Euro) stehen offenbar zur Debatte. Reparation in Höhe von 240 Milliarden Euro?
Die Premierministerin von Barbados, Mia Mottley, traf sich Anfang dieses Monats in London mit König Charles zu Gesprächen im Vorfeld des 56 Nationen umfassenden Commonwealth-Treffens. Mottley hatte zuvor bei den Vereinten Nationen gefordert, dass Reparationen für Sklaverei und Kolonialismus Teil eines neuen "globalen Neustarts" sein sollten.
Bitte weiterlesen bei Telepolis ...